Marbobo. Wenn die Islamisten der Terrormiliz IS die Grenze zur Türkei überschreiten, wären sie wohl die ersten Opfer: Rund 3000 syrisch-orthodoxe Christen leben noch im Südosten der Türkei. Manche von ihnen sind erst in den letzten Jahren aus Deutschland dorthin zurückgekehrt. Ein Besuch bei einer bedrohten Minderheit.
Einsam strahlt ein Licht in der Dunkelheit der Berge. Zwischen steilen Geröllhängen taucht der beleuchtete Kirchturm des syrisch-orthodoxen Klosters Mor Gabriel unvermittelt hinter einer Bergkuppe auf. Wer den Klosterhof betritt, hört aus dem Keller Gesänge. In einer kleinen Kapelle haben sich Mönche, Nonnen und Klosterschüler zum Abendgebet versammelt. Weihrauchschwaden ziehen durch den Raum. Auf Aramäisch, der Sprache Jesu Christi, beten die Gläubigen Psalmen und das Vaterunser. Schließlich segnet Abtbischof Timotheos Samuel Aktas die Menschen in der Kapelle mit einem kleinen goldenen Kreuz.
Gut 3000 syrisch-orthodoxe Christen leben heute noch im Südosten der Türkei, unweit der syrischen Grenze. Zwischen Midyat und Mardin, im Tur Abdin, einer Region, die sie den „Berg der Knechte Gottes“ nennen. Auf kargen Böden bauen die Menschen Wein und Melonen an, an den Hängen weiden Ziegen und Schafe. Einst waren die Christen hier in der Mehrheit, zählten viele Hunderttausend. Doch den Völkermord an den Armeniern und Aramäern 1915 bezahlten viele von ihnen mit dem Leben. Und die Kämpfe zwischen Türken und Kurden, bei denen die Christen oft zwischen die Fronten gerieten, sorgten dafür, dass noch vor 20 Jahren ein wahrer Exodus aus der Region stattfand. Für die letzten Christen der Region ist das Kloster Mor Gabriel ein geistliches Zentrum. „Wir hoffen und glauben, dass es für uns eine Zukunft geben wird“, sagt Erzbischof Aktas, als er eine kleine Delegation der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und den Siegener Bundestagsabgeordneten Volkmar Klein (CDU) empfängt.
Während der Erzbischof redet, servieren zwei Jungen Früchte und Tee. Sie sind Klosterschüler: Weil an den staatlichen Schulen der Türkei der Unterricht in aramäischer Sprache verboten ist, leben die Kinder der christlichen Familien des Tur Abdin für einige Zeit im Kloster. Tagsüber besuchen sie die staatliche Schule, nachmittags lernen sie Aramäisch. Offiziell erlaubt ist dieser Privatunterricht nicht. Die Behörden drücken ein Auge zu.
Immer wieder erlebten die Christen, eine Art Staatsbürger zweiter Klasse zu sein, beklagt der Erzbischof: Baugenehmigungen würden nicht erteilt, die Renovierung von Kirchen nicht genehmigt. Selbst der Landbesitz des seit dem 4. Jahrhundert durchgehend bewohnten Klosters ist umstritten: Kurdische Dörfer in der Umgebung verklagten die Mönche wegen „illegaler Ansiedlung“, derzeit sind noch drei Verfahren anhängig. Es geht um Felder, Gärten und die Klostermauer. „Hinter den Klagen steht das Ziel, uns von hier zu vertreiben“, sagt Aktas.
Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich deswegen schon für Mor Gabriel eingesetzt. Auf ihre Intervention hin gab der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dem Kloster einige Hektar Land zurück, die zuvor der Staat beanspruchte. „Die alten Klöster in dieser Region sind Symbole der verfolgten Christenheit“, betont Edgar Lamm, Vorsitzender der deutschen Sektion der IGFM. „Wir fordern eine offizielle Aufhebung des Verbots zur Erteilung des aramäischen Sprachunterrichts.“
In der ganzen Region haben die Christen derzeit kaum einen Grund zur Freude. „Wir hören nachts die Geschütze“, sagt Bülent Alkin. Bis vor einigen Jahren verkaufte der Familienvater Döner Kebap in Hamburg-Billstedt. Dann kehrte er zurück in das Dorf seiner Vorfahren, nach Marbobo. Von seiner Terrasse aus sieht man die syrische Grenze. „Natürlich haben wir Angst vor dem IS“, sagt Alkin. 1993 mussten die Christen schon einmal aus Marbobo fliehen: Islamistische Kämpfer der kurdischen Hisbollah vertrieben sie aus ihrer Heimat.
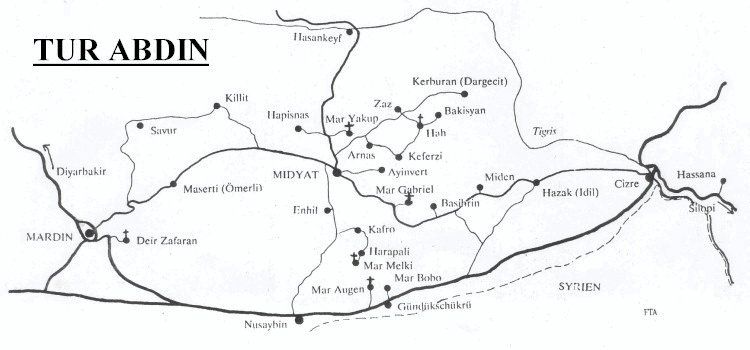
Heute haben die Christen ihre Häuser renoviert, die Kirche saniert. Doch schon seit 40 Jahren klagen die Leute von Marbobo dagegen, dass ihre fruchtbaren Baumwollfelder im Kataster ihrem islamischen Nachbardorf zugesprochen wurden. Ein Ende des Streits ist nicht im Sicht. Und während Alkin unter den Olivenbäumen seines Gartens von seinem Dorf erzählt, ziehen dunkle Wolken auf. „Die Menschen, die uns damals vertrieben haben, würden uns heute genauso vertreiben, wenn sich die Gelegenheit böte“, fürchtet der Heimkehrer, der zur Sicherheit seinen deutschen Pass behalten hat. „Aber wir sind nach Marbobo zurückgekommen, um zu bleiben.“
Einige Kilometer weiter westlich, beim Kloster Zaffaran, ganz in der Nähe der Provinzhauptstadt Mardin, sieht es schon ganz anders aus: Ein moderner Souvenirshop begrüßt die Besucher, eine mit EU-Mitteln sanierte Fassade strahlt weit über die Landschaft hinaus. Auch in Zaffaran haben die Christen Landprobleme, auch in Zaffaran wird der Aramäisch-Unterricht für Kinder nur geduldet. „Aber wir bemühen uns um gute Beziehungen zu unseren Nachbarn“, sagt Bischof Philoxenos Saliba Özmen. Mit dem vorigen Provinzgouverneur sei er persönlich befreundet gewesen, mit dem Nachfolger gebe es eine funktionierende Arbeitsbeziehung. Und auch zum muslimischen Müfti halte er Kontakt. „Wir brauchen Arbeitsplätze, damit sich die Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak hier niederlassen, und nicht nach Europa ziehen“, sagt der Bischof. „Wenn wir friedlich mit unseren Nachbarn zusammenleben können, können wir viel schaffen.“
Quelle: http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Zwischen-Furcht-und-Hoffnung-_arid,960583.html

